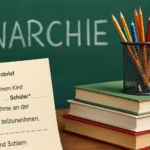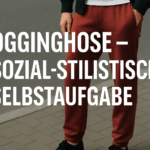Gefahr aus dem Supermarktregal
Für viele Verbraucher ist es ein alltäglicher Einkauf: ein Milchbrötchen, eine Fertigsuppe, ein alkoholfreies Bier. Doch was kaum jemand weiß – in all diesen Produkten kann Alkohol enthalten sein. Ohne dass er klar als solcher gekennzeichnet wird. Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) kritisiert: In vielen Fällen fehlt ein eindeutiger Hinweis, obwohl bestimmte Personengruppen zwingend darauf angewiesen wären.
In einem Bundesland wie Brandenburg, in dem Alkoholismus ein weit verbreitetes Problem darstellt, wird diese versteckte Gefahr zur ernsthaften Bedrohung. Denn wer abstinent lebt – ob freiwillig, aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer Suchterkrankung – läuft Gefahr, durch unklar deklarierte Produkte in einen Rückfall zu geraten.
Wenn “alkoholfrei” nicht wirklich frei von Alkohol ist
Die rechtlichen Regelungen ermöglichen es Herstellern, auch bei alkoholfreien Getränken bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol beizumischen. Erst ab 1,2 Volumenprozent greift eine verpflichtende Kennzeichnung als alkoholhaltiges Getränk. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss gezielt nach Produkten mit der Angabe „0,0 %“ suchen.
- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle
 Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Doch nicht nur bei Getränken lauern Risiken. Auch in Lebensmitteln wie Desserts, Kuchen mit Füllung, Aufbackwaren oder Fertigsaucen wird Alkohol oft eingesetzt – etwa als Trägerstoff für Aromen. In diesen Fällen besteht keine Pflicht, den Alkohol in der Zutatenliste zu nennen. Damit bleibt sein Einsatz für Konsumentinnen und Konsumenten meist völlig unsichtbar.
Die stille Rückfallgefahr für tausende Brandenburger
Nach aktuellen Zahlen sind in Brandenburg rund 2,1 Prozent der Bevölkerung alkoholkrank – das entspricht über 40.000 Betroffenen. Damit liegt das Land über dem Bundesdurchschnitt. Hinzu kommen Angehörige, abstinente Risikogruppen sowie Menschen, die aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen Alkohol strikt meiden.
Für viele von ihnen kann schon eine kleine Menge Alkohol in einem vermeintlich harmlosen Produkt einen Rückfall auslösen. Besonders perfide: Der Konsum erfolgt häufig unwissentlich – etwa durch ein Milchbrötchen, das mit Alkohol-haltigen Aromen hergestellt wurde, oder ein Dessert mit versteckter Weinnote. Die Schwelle zum bewussten Trinken sinkt, wenn Alkohol in kleinen Dosen unbemerkt zum Alltag gehört.
Kinder frühzeitig an den Geschmack gewöhnt?
Auch Kinder sind betroffen. Viele der betroffenen Produkte – Croissants, Kuchen, Süßigkeiten oder Malzbier – landen in der Brotdose oder im Einkaufswagen, ohne dass Eltern wissen, dass sie damit ihren Kindern Alkohol zuführen. Die Verbraucherzentrale warnt: Wer Kinder früh mit dem Geschmack von Alkohol in Kontakt bringt, senkt langfristig die Hemmschwelle für späteren Konsum.
- Schwedt im Überlebenskampf: Neue Hoffnung für den Industriestandort?
 Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Zwar sind die enthaltenen Mengen gering, doch die Signalwirkung ist fatal. Wenn „alkoholfreies“ Bier trotzdem Alkohol enthält oder ein Milchgebäck nach Rum schmeckt, entsteht ein falsches Verständnis von Normalität. Für ein Bundesland, das jedes Jahr Hunderte jugendliche Alkoholvergiftungen zählt, ist das ein alarmierendes Signal.
Gesetzliche Lücken ausgenutzt
Die Kritik der Verbraucherzentrale ist deutlich: Die derzeitigen Kennzeichnungsvorschriften greifen zu kurz. Zwar müssen Hersteller Alkohol als Zutat deklarieren – aber nur, wenn er auch tatsächlich als solche verwendet wird. Wird er hingegen als Trägerstoff eingesetzt, entfällt diese Pflicht. Auch die Begriffe, die verwendet werden, sind nicht einheitlich. „Ethanol“, „Ethylalkohol“ oder andere chemische Begriffe sagen vielen Verbrauchern nichts.
Die VZB fordert deshalb klare, sichtbare Hinweise auf der Verpackung – etwa auf der Vorderseite oder mithilfe eines Piktogramms. Nur so könnten Risikogruppen verlässlich informiert werden. Bisher allerdings fehlt es an politischem Willen, diese Regelungen zu verschärfen.
Brandenburger Realität: Risiko im Alltag
Die Suchtproblematik in Brandenburg ist keine Randerscheinung. Besonders in Regionen wie der Uckermark oder Cottbus ist der Anteil Alkoholkranker besonders hoch. Gleichzeitig sinkt zwar die Zahl der alkoholbedingten Klinikaufenthalte bei Jugendlichen leicht – doch von Entwarnung kann keine Rede sein.
- Arzttermin Brandenburg 2025: Monate warten, Patienten verzweifeln – so kommen Sie schneller dran
 Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.
Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.
2023 wurden allein 314 Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren mit akuter Alkoholvergiftung stationär behandelt. Das sind zwar weniger als im Vorjahr, aber immer noch eine alarmierende Zahl. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Auch deshalb ist der Umgang mit Alkohol – selbst in Kleinstmengen – eine Frage der Verantwortung. Und die beginnt bei der Kennzeichnung.
Ein Piktogramm gegen den Rückfall?
Die Lösung scheint einfach: Ein deutlich sichtbarer Hinweis auf Alkohol – ob als Zutat oder Trägerstoff. Ein einfaches Symbol auf der Verpackung, das für alle verständlich ist. So könnten Konsumenten besser informiert, Kinder besser geschützt und Rückfälle verhindert werden.
Die Realität aber ist komplizierter. Hersteller scheuen zusätzliche Warnhinweise, Verbraucher verlassen sich auf Begriffe wie „alkoholfrei“, und die Politik bleibt bislang untätig. Doch wer es ernst meint mit Verbraucherschutz, muss handeln – bevor aus einem Milchbrötchen ein Rückfall wird.