Arbeitslosenzahlen in Brandenburg: Kaum Veränderung trotz ESF-Förderung
Die aktuellen Arbeitslosenzahlen für Juli 2025 zeigen eine Quote von 6,3 Prozent in Brandenburg – 86.152 Menschen sind betroffen, 3.913 mehr als im Vorjahr. Zeitgleich zieht das Land Bilanz zu einem zentralen Förderinstrument: dem ESF-Programm „Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften“, das seit zehn Jahren Menschen den Weg zurück in Arbeit ebnen soll. Nach offiziellen Angaben konnten seit Projektstart 13.000 Personen erreicht werden, 3.700 wurden in Arbeit oder Bildung vermittelt – davon 2.700 in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Langzeitarbeitslosigkeit: Rückgang vorwiegend in konjunkturstarken Jahren
Zwischen 2015 und 2019 sank die Arbeitslosenquote in Brandenburg von 8,7 auf 5,8 Prozent – eine beeindruckende Entwicklung. Doch diese fiel in eine Phase stabiler Konjunktur und bundesweiter Arbeitsmarkterholung. Nach 2020 stagnierte der Trend: Die Quote bewegte sich bis 2023 um die 5,9 Prozent und steigt seitdem wieder. Dass im Jahr 2025 – nach einem Jahrzehnt gezielter Förderung – wieder ein Wert von 6,3 Prozent erreicht wird, legt nahe: Der Einfluss des Programms auf die Arbeitsmarktentwicklung ist begrenzt.
- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle
 Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Integrationsbegleitung: Individuell wirksam, aber gesamtstatistisch schwach
Rechnet man die Zahlen herunter, relativiert sich der Eindruck nachhaltiger Wirkung. 13.000 Teilnehmende über zehn Jahre – das sind etwa 1.300 Menschen pro Jahr. Bezogen auf rund 85.000 bis 90.000 registrierte Arbeitslose in Brandenburg jährlich erreicht das Programm damit kaum mehr als 1,5 Prozent der Betroffenen. Noch geringer fällt der Anteil der dauerhaft Vermittelten aus: Mit 2.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in zehn Jahren liegt die reale Vermittlungsquote bei unter 0,5 Prozent pro Jahr – verglichen mit der Gesamtarbeitslosigkeit.
Förderung von Langzeitarbeitslosen: Zu wenig für strukturellen Wandel
Das Programm setzt auf individuelle Betreuung – sozialpädagogisch sinnvoll, aber teuer und auf wenige Menschen begrenzt. Während Einzelfälle sicherlich profitieren, bleibt der gesamtgesellschaftliche Effekt überschaubar. Die Förderung Langzeitarbeitsloser erfolgt in einem Umfeld, in dem strukturelle Arbeitslosigkeit durch Bildungsarmut, geringe Qualifikation und Sprachbarrieren zusätzlich verfestigt wird. Gerade diese Probleme bräuchten langfristige, bildungspolitische Strategien – nicht nur zeitlich befristete Projekte.
- Uckermark verbessert Bürgerservice: LISA-Standort in Brüssow eröffnet
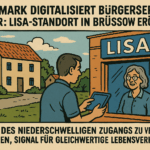 Die Uckermark hat in Brüssow einen neuen Standort des Landesportals LISA für Bürgerdienste eröffnet. Seit Ende September steht der Service zur Verfügung und soll den Zugang zu Verwaltungsleistungen im ländlichen Raum deutlich erleichtern.
Die Uckermark hat in Brüssow einen neuen Standort des Landesportals LISA für Bürgerdienste eröffnet. Seit Ende September steht der Service zur Verfügung und soll den Zugang zu Verwaltungsleistungen im ländlichen Raum deutlich erleichtern.
Arbeitsmarktförderung im Stresstest: Was bringen Projekte in Krisenzeiten?
Spätestens seit der Corona-Pandemie zeigt sich, wie stark Förderinstrumente an ihre Grenzen stoßen, wenn die wirtschaftliche Lage angespannt ist. Auch wenn Projekte flexibel auf Herausforderungen wie Sprachdefizite bei Migrantinnen und Migranten reagieren mussten, bleibt offen, wie nachhaltig diese Reaktionen waren. Zudem stellt sich die Frage, ob die Betroffenen auch langfristig stabil im Arbeitsmarkt bleiben oder nach Ende der Förderung erneut ins System zurückkehren.
Gute Ansätze, aber kein Hebel für den gesamten Arbeitsmarkt
Die Integrationsbegleitung ist zweifellos ein wichtiges soziales Angebot mit Wirkung auf persönlicher Ebene. Doch auf der Ebene des gesamten Arbeitsmarkts Brandenburg ist der Effekt gering. Die Rückkehr zur Quote von 6,3 Prozent im Jahr 2025 – identisch mit 2018 – zeigt: Ohne zusätzliche strukturelle Maßnahmen in Bildung, Qualifikation und Wirtschaftspolitik kann ein solches Programm bestenfalls stabilisieren, aber keine grundsätzliche Wende bringen. Die Arbeitsmarktförderung braucht darum mehr als gut gemeinte Einzelprojekte – sie braucht eine vernetzte, langfristige Strategie.





