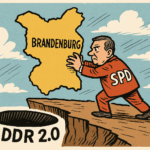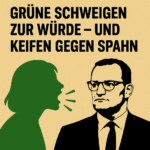Wenn Ausschüsse statt Wähler entscheiden
Gastkommentar von Norbert Rescher, MdL (AfD Brandenburg)
Dieser Beitrag gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Für den Inhalt trägt der Verfasser die alleinige Verantwortung. Er entspricht nicht notwendigerweise der Haltung oder Position des Verlages.
Das fragile Fundament der Demokratie
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Dieser Satz des Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde ist mehr als ein Bonmot. Er ist eine Warnung – und die Vorgänge um die Nichtzulassung des AfD-Kandidaten Joachim Paul zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen zeigen, wie aktuell diese Warnung ist. Ein Wahlausschuss ist ein Organ der Exekutive. Das verleiht ihm die Befugnis, die formalen Voraussetzungen einer Kandidatur zu prüfen. Mehr nicht. Ob ein Kandidat „verfassungstreu“ ist, darf er weder urteilen noch entscheiden. Genau das aber ist in Ludwigshafen geschehen: Ein nach Parteiproporz besetztes Gremium – SPD, CDU, FDP, Freie Wähler – verweigert einem AfD-Kandidaten die Zulassung, gestützt auf ein Schreiben des Verfassungsschutzes, das keine Tatsachenfeststellungen, sondern politische Wertungen enthält. Damit werden zwei Ebenen miteinander verknüpft, die in einer freiheitlichen Ordnung strikt getrennt sein müssen: Eine politisch geführte Behörde, die Gutachten schreibt, und ein parteipolitisch besetzter Wahlausschuss, der diese Wertungen zu Tatsachen erhebt – die Exekutive schwingt sich zur Judikative auf … Die Entscheidung über die Zulassung eines Kandidaten wird damit in den vorpolitischen Raum verlagert – weg vom Wähler, hin zu Gremien ohne richterliche Legitimation.
Das Gericht wiederum erkennt nicht die Dimension des Vorganges oder schreckt davor zurück: Es verweist auf die Stabilität der Wahl, verschiebt die Grundrechtsfrage in ein späteres Wahlprüfungsverfahren – und nimmt damit in Kauf, dass das passive Wahlrecht des Kandidaten faktisch ausgehebelt wird. Genau dieses Spannungsverhältnis beschreibt Böckenförde: Der Staat kann die Grundlagen der Demokratie nicht selbst schaffen, er kann sie nur achten. Sobald der Staat sein Instrumentarium nutzt, um unliebsame Meinungen oder Kandidaten auszuschließen, sägt er an dem Ast, auf dem er sitzt.
Wenn dieser Präzedenzfall Schule macht, wird das Vertrauen in den demokratischen Prozess massiv erschüttert. Der Wähler spürt sehr genau, wann ihm seine Entscheidung entzogen wird. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung ist das Gift für den inneren Frieden. Wer glaubt, damit die ungeliebte Konkurrenz ausschalten zu können, erreicht das Gegenteil: Die Legitimität der Institutionen leidet, die Wahlbeteiligung sinkt, die Extreme erstarken. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist robuster, als ihre Gegner glauben – aber sie ist nicht unzerstörbar. Wenn Wahlausschüsse nicht nur parteipolitisch besetzt, sondern auch politisch geführt werden, wenn Zweifel und Wertungen in einen Grundrechtseingriff umgewandelt werden, dann geht es längst nicht mehr nur um einen Kandidaten. Es geht um die Autorität des Grundgesetzes selbst.
Und was sind das für Demokraten, die glauben, den Wähler ausschließen zu müssen, um die Demokratie zu schützen? Vertrauen wir auf die Stärke unserer Demokratie – vertrauen wir dem Wähler. Nicht Ausschüsse, nicht Behörden, nicht Gutachten dürfen entscheiden, wer ein Amt ausüben darf. Der freie, der mündige Bürger wird als Souverän sein Urteil fällen. In hoffentlich freien, gleichen und geheimen Wahlen. Legen wir unser Vertrauen in ihn.