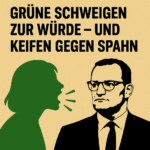Rainer Genilke (CDU) hakt nach
Der CDU-Abgeordnete Rainer Genilke wollte Klarheit. Seine Kleine Anfrage Nr. 593 zielte darauf ab, den Ablauf der Abschiebung der jesidischen Familie aus Lychen minutiös nachzuzeichnen und die Rolle der brandenburgischen Behörden wie auch von Innenminister René Wilke (Linke) transparent zu machen. Die Antwort der Landesregierung (Drucksache 8/1689, eingegangen am 29. August 2025, ausgegeben am 3. September 2025) liegt nun vor – und sie ist eindeutig: Eine Rückholung der Familie wird es nicht geben.
Genilke fragte präzise nach Stichtagen, Rechtsgrundlagen, Zuständigkeiten und nach den Versuchen der Landesregierung, nach der hochumstrittenen Abschiebung im Juli 2025 doch noch eine Rückkehr der Familie nach Brandenburg zu ermöglichen. Die Antworten zeichnen ein klares Bild von Verwaltungshandeln – und gleichzeitig von politischer Sprachlosigkeit.
Von Asylantrag bis Abschiebung – der lange Weg nach Bagdad
Die Chronologie der Landesregierung macht deutlich, wie lange sich der Fall hingezogen hat:
7. September 2022: Die Familie stellt einen Asylantrag in Deutschland.
20. März 2023: Das BAMF lehnt den Antrag als „offensichtlich unbegründet“ ab. Damit liegt ein klarer Bescheid vor, verbunden mit einer Abschiebungsandrohung.
20. April 2023: Das Verwaltungsgericht Potsdam weist den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab. Die Ausreisepflicht wird damit bestandskräftig bestätigt.
5. Mai 2023: Nach Ablauf der Frist gilt die Familie als vollziehbar ausreisepflichtig.
Ab Mai 2023: Die Ausländerbehörde des Landkreises Uckermark stellt regelmäßig Duldungen für jeweils drei Monate aus. Jede Duldung enthält eine auflösende Bedingung: Sie erlischt automatisch mit Bekanntgabe eines Abschiebetermins.
20. Februar 2024: Die Ausländerbehörde meldet die Familie zur Rückführung an die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) Brandenburg.
9. Mai 2025: Die ZABH beschafft Passersatzpapiere bei der irakischen Botschaft. Ohne diese Dokumente war eine Abschiebung vorher nicht möglich.
Mitte Mai 2025: Nach Erhalt der Reisedokumente meldet Brandenburg die Familie zur Sammelabschiebung.
22. Juli 2025: Unter Federführung Thüringens startet der Sammelcharter von Leipzig nach Bagdad. Genau an diesem Tag hebt das Verwaltungsgericht Potsdam die Ausreisepflicht per Eilantrag auf – da sitzt die Familie jedoch schon im Flieger.
Damit steht fest: Die Verwaltung hatte den Fall seit Frühjahr 2023 als erledigt betrachtet, die Familie jedoch durch wiederkehrende Duldungen in einem Schwebezustand gehalten. Erst als die Reisedokumente vorlagen, wurde gehandelt – und zwar mit äußerster Konsequenz.
Hilfsangebote zur freiwilligen Ausreise – abgelehnt, aber ohne Alternative
Ein wesentlicher Punkt in der Antwort der Landesregierung betrifft die Frage, ob der Familie Alternativen aufgezeigt wurden. Die Regierung erklärt, dass die Familie am 20. Februar 2024 eine Beratung über Hilfsangebote zur freiwilligen Ausreise endgültig abgelehnt habe. Auch spätere Angebote bei den Duldungsverlängerungen seien nicht angenommen worden.
Damit lässt sich feststellen: Die Behörden haben zwar formal ihre Pflicht erfüllt, über Programme zur freiwilligen Rückkehr zu informieren. Gleichzeitig zeigt die Antwort, dass die Familie klar gemacht hat, unter keinen Umständen in den Irak zurückkehren zu wollen – ein Land, in dem Jesiden nach wie vor Bedrohungen ausgesetzt sind.
Die Konsequenz war dennoch keine Prüfung von Alternativen wie etwa eines humanitären Bleiberechts, sondern die nüchterne Fortführung des Verfahrens, bis die Abschiebung umgesetzt werden konnte.
Federführung Thüringen, Formalismus in Brandenburg
Interessant ist auch die Frage der Zuständigkeiten. Die Brandenburger Landesregierung stellt klar, dass die Federführung für die Sammelabschiebung am 22. Juli 2025 beim Freistaat Thüringen lag. Brandenburg selbst meldete die Familie Mitte Mai 2025, nachdem die Papiere vorlagen, zur Sammelabschiebung.
Die Verantwortung wird damit auf mehrere Schultern verteilt: Das BAMF entschied über das Asyl, die Ausländerbehörde Uckermark stellte die Duldungen aus, die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg meldete die Familie an Thüringen, und von dort aus wurde die Sammelabschiebung organisiert. Am Ende bleibt der Eindruck: Jeder tat, was er musste – und niemand übernahm die politische Verantwortung, obwohl die Abschiebung im ganzen Land für Empörung sorgte.
- Schwedt im Überlebenskampf: Neue Hoffnung für den Industriestandort?
 Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Keine Ankündigungspflicht – eine juristische Spitzfindigkeit?
Besonders umstritten ist die Frage, ob die Familie über die konkrete Abschiebung hätte informiert werden müssen. Das Aufenthaltsgesetz schreibt vor, dass bei Familien mit Kindern unter zwölf Jahren eine Abschiebung mindestens einen Monat im Voraus anzukündigen ist, wenn eine Duldung widerrufen wird.
Die Landesregierung argumentiert, dass dies hier nicht zutraf: Die Duldung sei nicht widerrufen, sondern durch Eintritt der auflösenden Bedingung automatisch erloschen. Damit bestand nach ihrer Auffassung keine Ankündigungspflicht.
Diese juristische Spitzfindigkeit verdeutlicht, wie eng Verwaltung und Politik hier agieren: Formell alles korrekt, in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen.
Rückholung? „Fehlt an einer Rechtsgrundlage“
Innenminister René Wilke hatte nach der Abschiebung öffentlich eine Rückholung prüfen lassen. Doch die Antwort der Landesregierung ist unmissverständlich:
„Für eine Rückholung der Familie in das Bundesgebiet fehlt es an einer Rechtsgrundlage.“
Damit sind alle Hoffnungen zerstoben. Was öffentlich als Möglichkeit in den Raum gestellt wurde, wird in der Verwaltungssprache zu einem klaren Nein. Politisch bedeutet das: Versprochen wurde Empathie, geliefert wurde Bürokratie.
- Arzttermin Brandenburg 2025: Monate warten, Patienten verzweifeln – so kommen Sie schneller dran
 Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.
Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.
Die große Frage: Prioritäten der Politik
Die Debatte bekommt dadurch eine grundsätzliche Dimension. Während Brandenburg seit Jahren über Fachkräftemangel und Entvölkerung klagt, schafft es die Verwaltung, eine gut integrierte Familie mit vier Kindern konsequent abzuschieben – mitten aus einem funktionierenden Umfeld in Lychen heraus.
Gleichzeitig sind Fälle bekannt, in denen männliche, integrationsunwillige und straffällige Migranten trotz massiver Belastung für Sozialsysteme und Justiz weiterhin im Land bleiben. Warum gelingt hier kein ähnlicher Aktionismus?
Die Statistik zeigt:
Brandenburg schob 2024 insgesamt 233 Personen ab, hinzu kamen 36 Dublin-Überstellungen. Rund 955 Menschen ohne Bleibeperspektive verließen das Land – ein Anstieg um 20 Prozent.
Gleichzeitig liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger laut Polizeilicher Kriminalstatistik bei 41,1 Prozent, realistisch unter 34 Prozent, wenn ausländerspezifische Delikte herausgerechnet werden.
Die Zahlen verdeutlichen: Abschiebung ist möglich – wenn der politische Wille da ist. Doch anstatt bei Problemfällen durchzugreifen, setzt man ein Zeichen bei einer Familie, die längst Teil der Dorfgemeinschaft war.
Was bleibt – und die offene Frage
Zurück bleibt ein leerer Platz in der Schulklasse in Lychen, Aktenvermerke über einen Eilantrag, der zu spät kam, und ein Land, das mit aller Härte eine juristisch saubere Lösung durchsetzte – aber eine politisch fatale Entscheidung traf.
Die Drucksache 8/1689 dokumentiert Verwaltungsabläufe, die formell korrekt sind. Doch sie zeigt auch, wie Politik und Verwaltung an der Lebensrealität vorbei agieren.
Die entscheidende Frage lautet: Kann sich ein Bundesland, das dringend Zuwanderung und Arbeitskräfte braucht, wirklich leisten, integrierte Familien abzuschieben – während andere, die sich verweigern, bleiben dürfen?