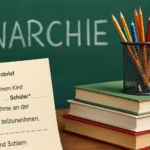Ideologie-Paradoxon: Empörung nach Maß
Wir leben in einer Gesellschaft, die stolz ist auf Toleranz, Vielfalt und Freiheit. Doch je nach Thema, Absender oder Ideologie ändert sich, wie scharf reagiert wird. Wenn eine Komödie oder ein Hollywood-Film angeblich Gefühle verletzt, schlägt die Empörungswelle hoch. Geht es dagegen um antisemitische Kunst in einer der weltweit wichtigsten Ausstellungen, bleibt die Kritik oft überraschend zurückhaltend.
Dieses Ideologie-Paradoxon zeigt: Die Härte der Reaktion hängt weniger vom Inhalt ab – sondern davon, wer kritisiert und wer betroffen ist.
„Barbie“ in Frankreich: Islamistische Drohungen statt Diskurs
In Noisy-le-Sec bei Paris wurde eine „Barbie“-Open-Air-Vorführung abgesagt, nachdem das Kinopersonal mit massiver Gewalt bedroht wurde. Französische Medien berichten von einem islamistisch geprägten Umfeld der Täter, die den Film als moralisch verwerflich brandmarkten.
Das ist keine kulturelle Debatte – das ist Erpressung durch Angst. Hier entscheidet nicht das Publikum, was es sehen darf, sondern der Lauteste mit der Drohung. Dass der französische Staat nun Ermittlungen eingeleitet hat, ist richtig. Aber der Schaden ist da: Ein Film verschwindet aus dem öffentlichen Raum – nicht durch Kritik, sondern durch Einschüchterung.
- Uckermark verbessert Bürgerservice: LISA-Standort in Brüssow eröffnet
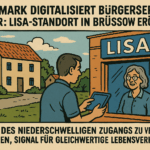 Die Uckermark hat in Brüssow einen neuen Standort des Landesportals LISA für Bürgerdienste eröffnet. Seit Ende September steht der Service zur Verfügung und soll den Zugang zu Verwaltungsleistungen im ländlichen Raum deutlich erleichtern.
Die Uckermark hat in Brüssow einen neuen Standort des Landesportals LISA für Bürgerdienste eröffnet. Seit Ende September steht der Service zur Verfügung und soll den Zugang zu Verwaltungsleistungen im ländlichen Raum deutlich erleichtern.
„Das Kanu des Manitu“: Woke-Subkultur diktiert die Tonlage
In Deutschland nimmt sich Michael „Bully“ Herbig mit „Das Kanu des Manitu“ selbst ins Visier der sogenannten Woke-Subkultur. Der Kultfilm von 2001 wird rückwirkend als rassistisch oder homophob gebrandmarkt, obwohl er damals Millionen zum Lachen brachte.
Für die Fortsetzung hat Herbig nach eigenen Worten einiges „entschärft“. Doch statt Applaus gibt es erneut Vorwürfe – diesmal, er hätte nicht genug gelernt oder sich zu oberflächlich entschuldigt. Verboten ist hier nichts – aber der Druck, sich an die moralischen Vorgaben einer lauten Minderheit anzupassen, ist spürbar. Kunstfreiheit lebt aber nicht von vorauseilender Selbstzensur.
Documenta 15: Antisemitische Kunst – und auffallend leiser Protest
Die Documenta 2022 in Kassel zeigte ein Werk mit klar antisemitischen Motiven. Es folgten internationale Berichte und Kritik – aber im Vergleich zu „Barbie“ oder „Manitu“ fehlte der flächendeckende Aufschrei.
Ja, das Bild wurde entfernt, ja, Kulturstaatsministerin Claudia Roth forderte Konsequenzen. Doch weder gab es massenhafte Boykottaufrufe noch einen medialen Dauerbeschuss, wie wir ihn bei anderen Fällen sehen. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Antisemitismus ist keine Meinung – er steht klar außerhalb der Kunstfreiheit.
- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle
 Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Cancel Culture, Islamismus, doppelte Standards
Ob woke Aktivisten, islamistische Moralhüter oder verharmlosende Kulturfunktionäre – das Muster ähnelt sich: Die eigene Sichtweise wird zur Norm erklärt, und wer abweicht, wird mundtot gemacht oder von der Bühne gedrängt. Mal durch Shitstorms, mal durch Gewaltandrohung, mal durch Schweigen, wo lauter Protest angebracht wäre.
Kunstfreiheit verteidigen – ohne Ausnahmen
Unsere europäischen Werte – Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, Vielfalt – gelten nicht nur, wenn uns das Werk gefällt. Sie gelten gerade dann, wenn wir anderer Meinung sind.
Das bedeutet:
- Kritik ja, Gewalt nein.
- Konsequentes Vorgehen gegen jede Form von Einschüchterung, egal ob sie woke, religiös oder politisch motiviert ist.
- Gleiche Maßstäbe bei Antisemitismus, Rassismus oder anderen Formen von Diskriminierung – ohne ideologische Brille.
Wer hier mit zweierlei Maß misst, gefährdet nicht nur einzelne Künstler, sondern das Fundament unserer freien Gesellschaft.