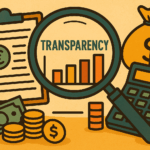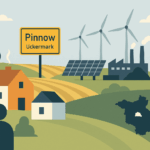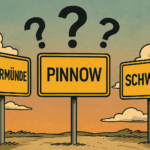Die Anfrage – ein Polit-Thriller im Mini-Format
Offiziell klang das Ganze harmlos. In der Drucksache AFAU/022/25 fragte „Die Opposition“ am 5. August 2025, ob Mitglieder der SVV oder sachkundige Bürgerinnen vom Verfassungsschutz beobachtet würden, wie in solchen Fällen die Vertraulichkeit nichtöffentlicher Sitzungen gewährleistet werden könne und welche Maßnahmen die Stadt zum Schutz vor extremistischen Einflüssen ergreife.
Schon die Begründung ließ aufhorchen: Mit Verweis auf die bundesweite Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem wurde suggeriert, auch auf kommunaler Ebene müsse geprüft werden, ob die Zusammensetzung der Gremien überhaupt „sauber“ sei. Doch auffällig war: Linksextremismus, Islamismus oder andere Gefahren für die Demokratie wurden mit keinem Wort erwähnt. Statt um Extremismus an sich ging es allein um den politischen Gegner rechts der Mitte – eine klare Schlagseite.
Facebook-Show statt parlamentarischer Arbeit
Noch bevor die Anfrage im Hauptausschuss behandelt werden konnte, gab es die große Inszenierung im Netz. Sascha Kunkel (Die PARTEI, Die Opposition) postete am 15. August 2025 süffisant über ein „Demokratie-Schutzprogramm mit Aluhutprüfung“.
Dazu ironische Ideen wie:
- Eintritt nur nach „Demokratie-TÜV“
- Handys bitte auf den „Aluhut-Parkplatz“
- „Extremistenfreie Zone bis auf Weiteres“
Das war kein ernsthafter Beitrag zur Debatte, sondern pure Boulevard-Provokation. Und genau das war gewollt: mehr Aufmerksamkeit, mehr Klamauk, weniger inhaltliche Substanz.
Die Fakten waren längst klar
Während „Die Opposition“ auf Social Media Stimmung machte, lagen die harten Fakten schon Monate vorher auf dem Tisch:
Landesregierung Brandenburg: Bereits am 09. Mai 2025 erklärte die Innenministerin unmissverständlich, dass der Schwedter Abgeordnete Norbert Rescher weder als „gesichert rechtsextrem“ noch als „erwiesen rechtsextrem“ eingestuft ist. Auch sonst gab es keinerlei öffentliche Verlautbarung, die dies nahegelegt hätte.
Bundesamt für Verfassungsschutz: Am 16. Juli 2025 teilte das BfV mit, dass keine Daten über seine Person gespeichert sind. Wörtlich heißt es: „Es existieren im NADIS und in sonstigen Dateien auch keine Hinweise.“ Damit war endgültig klar: kein Eintrag, keine Beobachtung, keine Einstufung.
Stadtverwaltung Schwedt: Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe stellte am 07. August 2025 klar: Der Verwaltung liegen keinerlei Informationen über Beobachtungen von Stadtverordneten oder sachkundigen Bürgern vor. Zudem sei die Verschwiegenheitspflicht gesetzlich geregelt. Verstöße könnten sanktioniert werden – zusätzliche Maßnahmen gebe es nicht und brauche es auch nicht.
Kurz: Alles war längst geklärt.
Für beantwortet erklärt – aber die Schlagzeilen bleiben
Am 03. September 2025 wurde die Anfrage schließlich im Hauptausschuss behandelt – und dort für beantwortet erklärt. Formal ist die Sache erledigt, doch der politische Nachgeschmack bleibt: Die Debatte hat längst Schlagzeilen produziert, Misstrauen geschürt und das Klima vergiftet.
- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle
 Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.
Fragerecht oder politischer Pranger?
Das Fragerecht ist in der Brandenburger Kommunalverfassung (§ 29 BbgKVerf) fest verankert. Es soll Transparenz schaffen, Kontrolle ermöglichen und der Opposition ein wichtiges Werkzeug an die Hand geben. Doch genau dieses Instrument wurde in Schwedt jetzt zum Streitpunkt.
Die AfD-Fraktion spricht in ihrer Pressemitteilung von einem „gefährlichen Präzedenzfall“: Statt zur Aufklärung beizutragen, werde das Fragerecht instrumentalisiert, um gewählte Vertreter öffentlich unter Verdacht zu stellen. Die bloße Einstufung einer Partei auf Landes- oder Bundesebene reiche plötzlich, um das Verhalten einzelner Kommunalpolitiker infragezustellen – auch dann, wenn keinerlei individuelle Verdachtsmomente vorliegen.
Das Problem: Wird das Fragerecht auf diese Weise zum Pranger, verliert es seine eigentliche Funktion. Denn es öffnet Tür und Tor für politische Inszenierungen:
- Heute geht es gegen vermeintlich rechte Abgeordnete.
- Morgen könnten linke Mandatsträger ins Visier geraten – ganz ohne konkrete Anhaltspunkte.
- Am Ende steht nicht mehr die Sache im Mittelpunkt, sondern die Diskreditierung von Personen.
Genau hier liegt der Knackpunkt: Demokratie lebt vom Streit um Inhalte – nicht von Stigmatisierungen durch Suggestivfragen. Wenn Anfragen nicht der Kontrolle dienen, sondern allein dem Rufschaden politischer Gegner, dann kippt der Sinn des Instruments. Aus einem Werkzeug der Transparenz wird eine Waffe im Meinungskrieg.
Die AfD-Fraktion warnt daher:
„Wenn das Fragerecht in einen politischen Pranger verwandelt wird, verliert nicht nur unsere Fraktion Vertrauen in faire Verfahren – es trifft die gesamte Stadtgesellschaft.“
Denn Bürgerinnen und Bürger könnten den Eindruck gewinnen, dass Politik nicht mehr um Lösungen ringt, sondern nur noch um Schlagzeilen und Skandale.
Besonders auffällig: Die Anfrage zielte einseitig auf den vermeintlich rechten Rand. Linksextremismus, Islamismus oder andere Gefahren für die Demokratie wurden nicht thematisiert. Ein Demokratie-Schutz, der nur eine Richtung kennt, ist aber keiner – sondern eine politische Waffe.
Damit stellt sich die entscheidende Frage: Darf das Fragerecht als Bühne für populistische Kampagnen genutzt werden? Oder braucht es klare Grenzen, damit Kontrolle nicht zur Diskreditierung verkommt?
- Schwedt im Überlebenskampf: Neue Hoffnung für den Industriestandort?
 Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.
Das eigentliche Ziel: Stigmatisierung
Alles zusammengenommen ergibt sich ein klares Bild:
- Die Fakten waren bekannt.
- Es lag keine Beobachtung vor.
- Weder Landesregierung noch Bundesamt für Verfassungsschutz fanden Belastendes.
Und trotzdem wurde die Anfrage mit großem Tamtam in die SVV getragen und auf Facebook zugespitzt. Ziel war nicht Aufklärung, sondern das öffentliche Stigmatisieren politischer Gegner – und zwar ausschließlich auf der rechten Seite des politischen Spektrums.
Das Boulevard-Finale in Schwedt
Am Ende bleibt die Frage: Was bleibt von dieser Anfrage?
- Keine neuen Fakten. Alles war längst klar.
- Kein Beitrag gegen Extremismus. Linksextremismus, Islamismus oder andere Gefahren wurden völlig ignoriert und eine Gefahr von rechts bereits lange ausgeschlossen.
- Ein billiger Show-Effekt. Mit Aluhut-Witzen und Social-Media-Posts.
Die Anfrage von „Die Opposition“ war kein Beitrag zu mehr Transparenz oder Sicherheit, sondern ein politisches Theaterstück. Sie zielte nicht auf Extremismus als Ganzes, sondern ausschließlich auf den politischen Gegner. Am Ende bleibt ein Aufreger ohne Substanz – und die Erkenntnis, dass Populismus auch im kommunalen Rahmen bestens funktioniert.